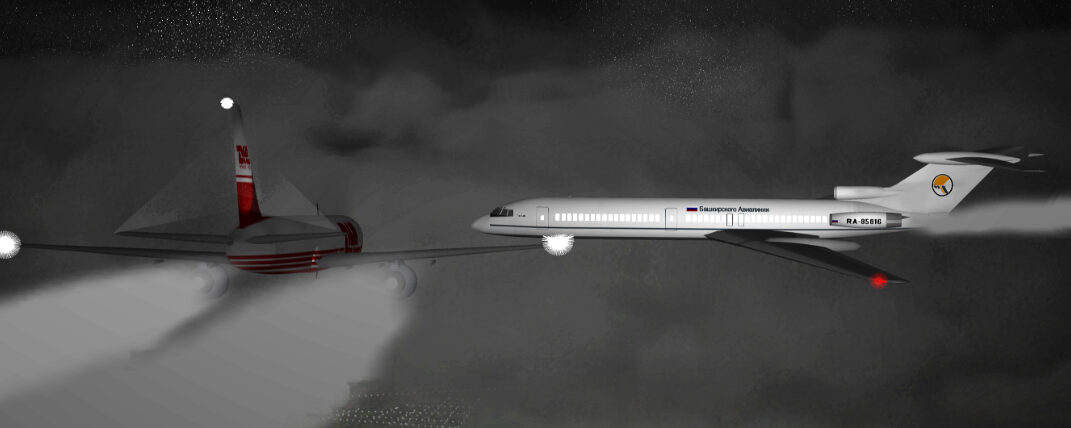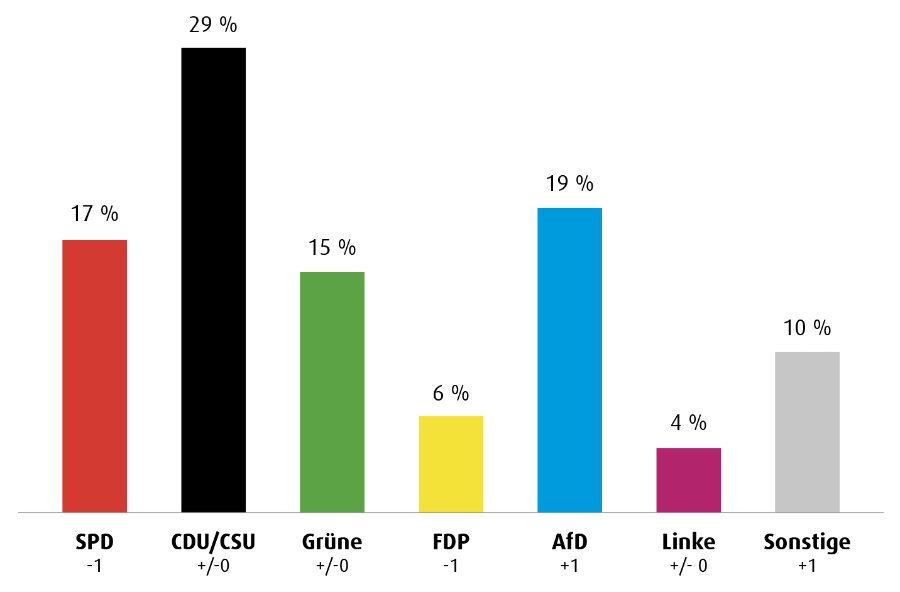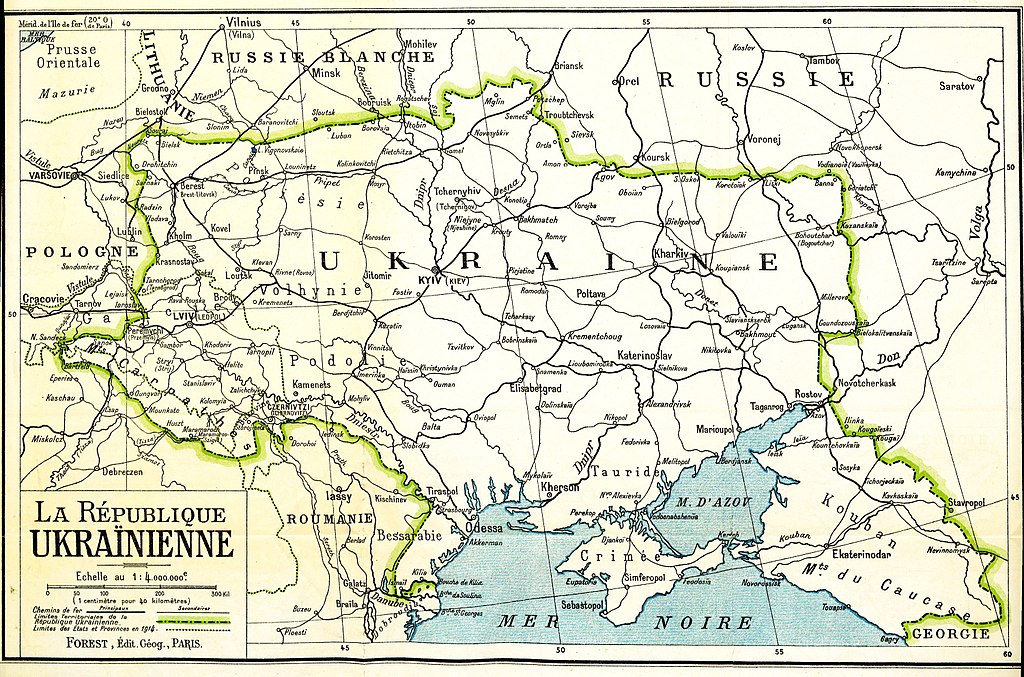„So heiß wie seit mindestens 125.000 Jahren nicht“, titelt die Tagesschau. Gemeint ist damit eine Schätzung (!) des europäischen Klimawandeldiensts „Copernicus Climate Change Service“, wonach der vergangene Oktober weltweit im Schnitt 1,7 Grad wärmer war als vor Beginn der Industrialisierung. „Der Rekord wurde um 0,4 Grad Celsius gebrochen, was eine enorme Marge ist“, sagt Samantha Burgess, die stellvertretende Copernicus-Direktorin. An der Meeresoberfläche seien so hohe Temperaturen gemessen worden wie noch nie in einem Oktober.

Schon im Juni hat die Erde erstmals im Sommer die Schwelle eines 1,5-Grad-Temperaturanstiegs gegenüber dem 19. Jahrhundert überschritten. Diese Schwelle, erläuterte damals der „Focus“, „ist deshalb bedeutsam, weil sich die Weltgemeinschaft bei der Pariser Klimakonferenz im Jahr 2015 darauf geeinigt habe, die Erderwärmung bis zum Jahr 2100 auf maximal 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen“.
Umstrittene Interpretation
Bei Copernicus geht man noch weit über solche Aussagen hinaus. Und das, obwohl der EU-Einrichtung lediglich Wetterdaten seit den 1940er Jahren vorliegen. „Wenn wir unsere Daten mit denen des IPCC kombinieren, können wir sagen, dass dies das wärmste Jahr der vergangenen 125.000 Jahre ist“, meint Vize-Direktorin Burgess. Der sogenannte „Weltklimarat“ IPCC greift laut der Erläuterung im Tagesschau-Beitrag auf Messwerte zurück, die auf der Auswertung von Eisbohrkernen, Baumringen und Korallen-Ablagerungen basieren. Genau deren Interpretation ist aber umstritten.

Andere Forscher gehen davon aus, dass der Nullpunkt der Klima-Diskussion, also der Beginn der Industrialisierung, der kälteste Zeitpunkt der zurückliegenden 10.000 Jahre ist. Seit Ende der letzten großen Eiszeit. Soweit muss man freilich nicht gehen. In jedem Fall aber liegt jener Bezugspunkt am Ende der sogenannten „Kleinen Eiszeit“. Sie dauerte mit wechselnder Intensität vom ausgehenden Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein an. Die Temperaturen lagen damals merklich unter denen des 20. Jahrhunderts, aber auch unter denen früherer Epochen wie Hochmittelalter oder klassische Antike.
Der Mensch ist schuld
Schuld an den vermeintlichen oder tatsächlichen Temperatur-Rekorden des Jahres 2023 sind laut dem Tagesschau-Beitrag – wie könnte es anders sein – die Kohlendioxid-Emissionen des Menschen. Dazu passend liefert ein zweiter Beitrag sogleich eine weitere Anklage an die Adresse der Befürworter fossiler Brennstoffe. Das Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad sei „mit den geplanten Fördermengen an Kohle, Öl und Gas kaum zu erreichen“, heißt es mit Verweis auf einen Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP). Die globale Öl- und Gasförderung verschärfe die Klimakrise.

Kein Wort liest man dagegen vom untermeerischen Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai im Pazifik. Dessen Mega-Eruption im Januar 2022 löste nicht nur einen Tsunami aus, verwüstete den Insel-Staat Tonga und störte die Satelliten-Kommunikation. Sie schleuderte auch enorme Mengen an Wasserdampf in die Atmosphäre. Der Ausbruch war nach Analysen von Vulkanologen eine der stärksten jemals gemessenen Eruptionen. Die Explosionsstärke war weit stärker als alle jemals durchgeführten Kernwaffentests und in etwa vergleichbar mit dem Ausbruch des Krakatau 1883. Jene Groß-Eruption führte auf der Nordhalbkugel zu einer um etwa 0,5 bis 0,8 Grad kühleren Temperatur.
Untypisch für einen Vulkan
Anders der Hunga Tonga. Experten zufolge erhöht die enorme Menge des in die Atmosphäre geschleuderten Wasserdampfs die globalen Temperaturen auf Jahre hinaus. Zwei Wochen nach der Eruption überwog der das Klima erwärmende Effekt der mehr als 100 Megatonnen Wasserdampf in der Stratosphäre den kühlenden Effekt der Schwefelaerosole. Eine Studie kam 2023 zu dem Schluss, dass der Wasserdampf „vermutlich und für einen großen Vulkanausbruch untypisch“ zu einem vorübergehenden globalen Temperaturanstieg führen werde. Auf mehr als 1,5 Grad gegenüber dem Beginn der Industrialisierung.

Andere Wissenschaftler meinen zwar, das der abkühlende Effekt der Aerosole überwogen und im Sommer 2022 sogar eine leichte Abkühlung verursacht habe. Die Gesamtmenge an Schwefeldioxid aber, die durch die Eruption in die Atmosphäre gelangte, wird auf nur 0,4 Megatonnen geschätzt. Ein fühlbarer Einfluss auf das Klima wäre laut Atmosphären-Forschern aber erst ab fünf Megatonnen zu erwarten. „Was die wahrscheinlichen Auswirkungen auf das Klima betrifft“, sei der Ausbruch des Hunga Tonga „einem Dutzend anderer Eruptionen in den letzten 20 Jahren nicht unähnlich“, erklärt Brian Toon von der University of Colorado.
Mehr Extrem-Wetter?
Davon liest man bei der Tagesschau nichts. Stattdessen dies: „Der Klimawandel führt zu Extremereignissen.“ Dazu gehörten laut dem Flaggschiff der öffentlich-rechtlichen Nachrichten-Vermittlung in diesem Jahr Überschwemmungen in Libyen, die Tausende Menschen töteten, heftige Hitzewellen in Südamerika und die schlimmste Waldbrandsaison, die Kanada je erlebt hat. Die tödlichen Fluten wurden indes nicht durch den Klimawandel oder steigende Temperaturen ausgelöst. Sondern durch den Bruch zweier veralteter Staudämme, deren mangelnde Widerstandskraft gegen Hochwasser Experten bekannt war und die zudem nur unzureichend gewartet wurden.

Auch verursacht eine mögliche Erderwärmung keine Waldbrände. Auch wenn dies gut ins medial transportierte Bild von der Klima-Hölle passen würde. Bestenfalls können Dürre und Trockenheit dazu beitragen, dass ein entstandener Brand mehr Nahrung erhält. Grund für die teils verheerenden Feuer aber ist nicht das steigende Thermometer. Sondern meist Brandstiftung oder Fahrlässigkeit. Belege dafür gibt es zuhauf. Insbesondere aus den europäischen Waldbrand-Gebieten. Das aber erfährt der durchschnittliche Tagesschau-Leser bestenfalls im Kleingedruckten.
Thomas Wolf