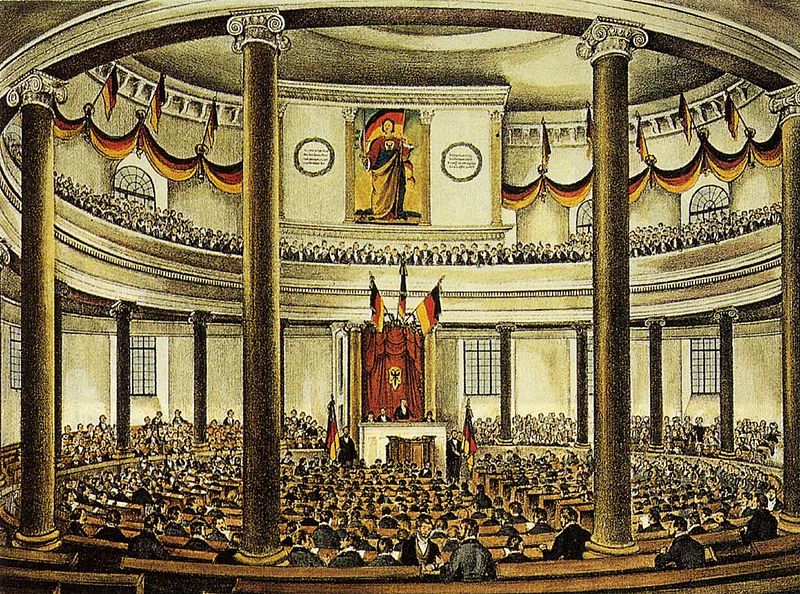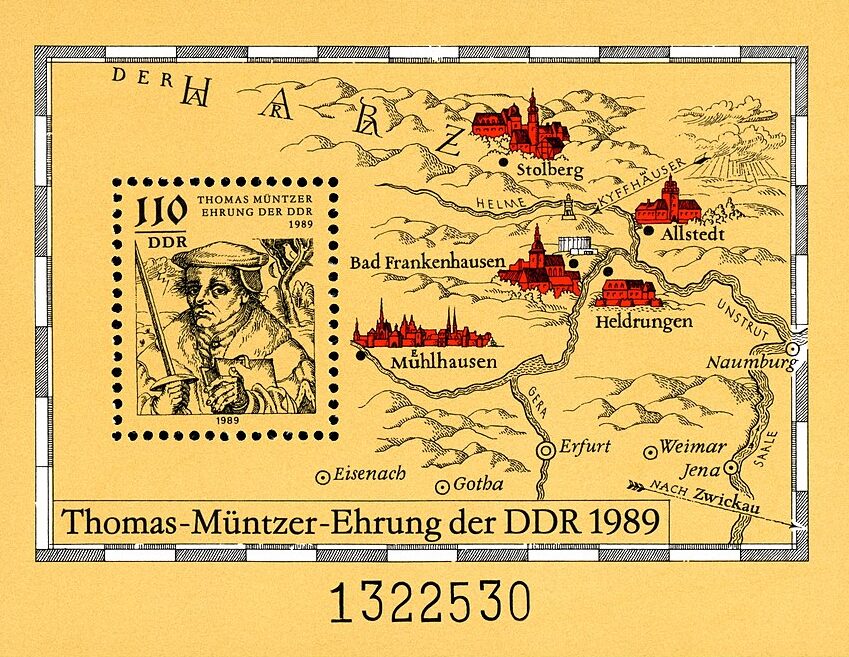Nina Popova ist 40 Jahre und lebt in der russischen Region Krasnodar nahe der Küste des Schwarzen Meeres. Auf Telegram betreibt sie die deutschsprachigen Kanäle „DRN Deutsch-Russische Nachrichten“ und „Politik für Blondinen“. Deutschland kennt und liebt sie, seit sie als Kind mit ihrer Familie in die Bundesrepublik kam. Einst machte sie Wahlkampf für die CDU. Zurück in Russland ist sie seit 2019. Im Interview erzählt Nina von ihrer neuen und alten Heimat, ihrer Haltung zum Krieg in der Ukraine, der russischen Liebe zu Deutschland und der Zukunft der deutsch-russischen Beziehungen.

Nina, in westlicher Wahrnehmung gibt es in Russland praktisch keine privaten Medien mehr, sondern nur noch staatliche. Wie sieht die Situation tatsächlich aus?
Es gibt einige freie Journalisten, die ich sehr gerne lese. Als Journalist ist man in Russland frei zu schreiben, was man will, solange keine Gesetze verletzt werden. Die Gesetze sind im übrigen den westlichen ähnlich. Solange keine radikalen Aufrufe enthalten sind, darf man schreiben. Die Situation der freien Medien wird eher vom Westen her erschwert. So hat man mit einer russischen IP-Adresse keinen Zugriff auf deutsche Medien. Russland sperrt keine Nachrichten aus. Es werden sogar Tipps gegeben, wie man westliche Medien weiterhin lesen kann.
Das heißt konkret: Wie informierst Du Dich?
Ich nutze wie empfohlen VPN, um weiterhin alle Nachrichten aus aller Welt zu lesen. Selbstverständlich lese ich alle großen deutschen Nachrichtenagenturen, ebenso englischsprachige Medien und natürlich die in russischer Sprache. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass ich so am besten fahre. Wobei die westlichen Medien mittlerweile sehr viel behaupten und nicht wirklich prüfen.
Wie berichten russische Medien über den Krieg in der Ukraine?
Vielseitig. Das trifft es wohl am besten. Es gibt Berichte direkt von der Front, Augenzeugenberichte usw. Was mich hier sehr erstaunt, ist, dass gegen andere Länder oder Menschen in keiner Weise gehetzt wird.
Du betreibst zwei Telegram-Kanäle mit Nachrichten aus Russland. Welche Rolle spielen Fake News in Deiner täglichen Arbeit?
Fake News erschweren meine Arbeit. Ich gebe mir Mühe, alles zu prüfen, was ich veröffentliche. Mir ist es wichtig, dass man nicht schockiert oder nur kritisiert. Ich möchte, dass man sich informieren kann. Natürlich ist es gerade bei dringenden Nachrichten schwierig, immer gleich zu prüfen, ob sich keine Fake News dahinter verbergen. Bisher hatte ich Glück oder einfach ein Gefühl dafür, was nicht stimmt. Sollte es mir dennoch mal passieren, so würde ich das selbstverständlich auch berichten.

Du lebst in der Nähe von Krasnodar, nicht weit von der Brücke über die Straße von Kertsch auf die Krim-Halbinsel. Wie nah ist Dir der Krieg?
Dieser Krieg ist mir nah. Im Oktober bin ich von der Explosion der Brücke aufgewacht. Aber auch menschlich ist er uns nah. Ich habe Verwandte in der Ukraine. Ich sehe täglich Flüchtlinge aus der Ukraine. Wie viele Menschen hier tun auch mir diese Menschen, die alles verloren haben, leid.
Du bist schon mehrfach in Frontnähe gewesen und hast Soldaten besucht. Wie sehen diese Besuche konkret aus – was macht Ihr dort?
Ich habe Freunde, die eingezogen worden sind. Wir sind sozusagen die Feldpost. Wie bringen Briefe oder Päckchen von den Familien der Jungs. Ich bin vor allem mitgefahren, weil ich mir ein eigenes Bild machen wollte und einfach musste.

Wie organisiert Ihr die Besuche? Welche Rolle spielen dabei der Staat oder das Militär?
Wir fahren mit anderen Freiwilligen. Selbstverständlich bedarf es der Erlaubnis von der Armee. Der Staat spielt bei unseren Unternehmungen nur soweit eine Rolle, dass wir eine Erlaubnis brauchen. Ansonsten ist es wie gesagt freiwillig. Wir tragen die Kosten selbst.
Du warst im Zuge Deiner Besuche vor einiger Zeit auch in Mariupol. Die Stadt ist eines der Symbole für den Krieg und die Zerstörungen, die er verursacht. Zumindest im Westen. Wie ist die Situation dort?
Die Stadt hat mich unheimlich berührt. Es ist für mich kaum vorstellbar, was diese Menschen ertragen haben müssen. Diese Stadt ist eine Stadt der Gegensätze geworden. Man erahnt ihre einstige Schönheit. Und sie erwach wieder zum Leben. Ich habe die Neubaugebiete selbst gesehen. Aber es ist noch viel zu tun.
Mich hat die Freundlichkeit der Menschen dort berührt.

Du hast große Teile Deiner Kindheit und Jugend in Deutschland verbracht, bist deutsche Staatsbürgerin und wohnst erst seit wenigen Jahren wieder in Russland. Worin unterscheidet sich das Leben in beiden Ländern?
Ich habe 30 Jahre meines Lebens in Deutschland verbracht. Ich mag beide Länder sehr gerne, aber in Russland ist das Leben entschleunigt. Man hat irgendwie mehr Zeit – also wenn man nicht gerade in Moskau lebt. In Deutschland hatte ich oft wenig Zeit für meine Familie. Hier ist die Ausrichtung der Werte viel mehr auf Kinder und Familie ausgerichtet. Ich arbeite und habe dennoch mehr Zeit.
Wie denkst Du heute über Deutschland?
Ich habe viele Freunde und auch Teile der Familie immer noch in Deutschland. Mir ging es auch in Deutschland gut. Ich habe mich aus persönlichen Gründen für den Umzug entschieden. Wobei ich sagen muss, dass ich die heutige Regierung in Deutschland nicht ganz verstehe und mir aus meiner Sicht mehr Neutralität wünschen würde.
Was stört Dich an Russland?
Es sind eher meine angewöhnten Eigenheiten oder Sachen, die ich aus Deutschland gewohnt war – wie Pünktlichkeit. Die ist hier manchmal ein dehnbarer Begriff. Außer der russischen Bahn: Die ist auf die Sekunde pünktlich! Und mich stört die Grundentspanntheit mancher Handwerker.
Wie könnte für Deutschland und Russland ein Ausweg aus der aktuellen Spirale von Sanktionen, Hetze und Hass aussehen? Wie könnten sie zurückfinden zu alter Freundschaft?
Ich wünsche mir, dass Deutschland wieder mehr Neutralität walten lässt. Der radikale Kurs der deutschen Regierung wird auch eine zukünftige diplomatische Zusammenarbeit unmöglich machen. In Russland wird nicht gegen das deutsche Volk gehetzt. Niemand wünscht sich, Deutschland zu zerstören. Ich lese ja diese Sachen in den deutschen Medien und bin bestürzt. In Russland sind die Menschen Deutschland gegenüber immer positiv eingestellt gewesen. Man schätzt hier deutsche Autos, deutsches Bier und die Industrie in Deutschland. „Made in Germany“ ist ein Qualitätsmerkmal. Als ich meine Kanäle schuf, wollte ich, dass unsere Völker das Verständnis füreinander nicht verlieren.
Interview: Thomas Wolf